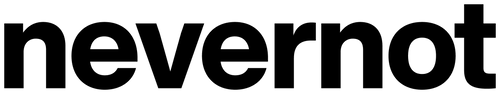Kolumne: No Big Deal?
Seit einer guten halben Stunde starre ich auf die leere Word-Seite vor mir. In meinem Kopf tausend Gedanken, keiner davon klar. Denn, wenn man mich im Privaten fragt, was ich zum Thema Körperkram zu sagen habe, lautet meine Antwort je nach Tag, Absender*in und mentaler Verfassung häufig: Nichts. Nicht weil ich tatsächlich nichts zu sagen hätte, sondern weil meine Antwort nicht in zwei bis drei locker daher gesagte Sätze passt. Und vor allem, weil ich keine ehrliche Antwort geben kann, ohne einen emotionalen Striptease hinzulegen, den ich, bei aller Liebe, nicht in jeder beliebigen Dinner-Konversation mit entfernten Bekannten vollziehen will.
Seit ich denken kann, bin ich mehrgewichtig. Erst nur wenige Kilo – ich war eben das Kind, das ein kleines bisschen pummelig ist. ‘No big deal’, der süße Babyspeck verwächst sich, sagten die Erwachsenen über mich. Dann kam die Pubertät. Plötzlich war ich nicht mehr süß, sondern fett. Und ‘believe me’: Anfang bis Mitte der Nullerjahre – zu Zeiten von Size Zero, als Nicole Richie und Paris Hilton das gängige Körperideal vertraten – war das keineswegs eine neutrale oder gar empowernde Selbstbezeichnung. Ich trug erst Kleidergröße 42, später 44 / 46. Beim Betreten des damaligen ‘Holy Ground’ aller coolen Kids, dem lokalen Miss Sixty-Store, erntete ich erst abschätzige Blicke, dann den Kommentar “SO große Größen stellen wir nicht her, sorry”. Wenn sich Jungs für mich interessierten, gab es von ihren Freunden meist einen abwertenden Spruch. Vieles, was für andere Alltag war, empfand ich als Spießrutenlauf. Weight Watchers, FDH, Fitnessstudio – Diätversuche wechselten sich ab mit frustrierter Resignation und der vermeintlichen Einsicht, dass ich wohl einfach zu undiszipliniert, nein, einfach nicht gut genug sei.
Wie man da nicht zum Mobbing-Opfer, zur sozialen Außenseiter*in wird? Meine Strategie war lustiger, mutiger und vor allem schlagfertiger als alle anderen zu sein. Oder kurz: Die “Try me, bitch”-Strategie. Kein verletzender Spruch blieb ungesühnt, meine Attitüde wurde meine Rüstung, meine Zunge mein Schwert. Ich war hart. Das ist noch heute so und dafür bin ich oft dankbar. Was anders geworden ist, ist mein Umgang mit mir selbst. Und dafür bin ich noch viel dankbarer. Heute hasse ich mich nicht mehr dafür, fett zu sein. Denke nicht mehr, dass ich hässlich bin, nur weil ich fett bin. Weiß, dass Diätkultur, Medien und Sozialisierung mich jahrelang krank gemacht und immer weiter in einen Teufelskreis aus Frustessen und Selbsthass gezogen haben. Und ich weiß, nein, ich FÜHLE, dass ich genug bin.
Diesen ‘Mindset Shift’ verdanke ich auch der Body Positivity-Bewegung. Den Fat-Fluencer*innen, die die Kämpfe, die ich täglich im Privaten geführt habe, auf der großen Bühne ausgetragen haben. Die sich Spott, Hohn und Hass aussetzten, um anderen Fetten zu zeigen, dass sie sich nicht verstecken müssen. Dass fett nicht hässlich bedeutet. Und dass Mode für alle Körpertypen da ist. Ich bin mir sicher, dass mein eigener Kampf mit dem Körperkram deutlich anders verlaufen wäre, hätte ich damals mit 14 in der Bravo Lizzo statt Paris gesehen.
Und dennoch bin ich der Bewegung gegenüber mittlerweile oft ambivalent. Denn die Rigidität, mit der es mir vielerorts im Internet “YOU MUST LOVE YOUR BODY!” entgegenschreit, finde ich irritierend. Mehr noch: ich fühle mich davon unter Druck gesetzt. Kann ich nicht auch meinen Körper akzeptieren, ohne gleich jeden Dehnungsstreifen und jede Speckrolle geil zu finden? Auch mal darüber fluchen, dass ich mich gerade unwohl fühle, weil die fünf Kilo mehr nach Weihnachten mich beim Yoga ordentlich aus der Puste bringen, ohne als Nestbeschmutzerin zu gelten? Und müssen wir nicht viel mehr lernen, unseren Selbstwert nicht so stark an Äußerlichkeiten zu koppeln, als nur mantraartig zu skandieren, dass jeder Körper schön ist?
Diese Bestätigung anderer und die Repräsentanz in den Medien können nur kleine Teile des Puzzles sein, auch wenn sie wichtig sind. Denn wenn ich eines auf meiner eigenen Körperreise gelernt habe, ist es, dass ich mein Verständnis von Schönheit nicht ändern muss. Um mich anzunehmen, mich und meinen Körper gar zu lieben, muss ich lernen, meine inneren Verletzungen zu heilen – der Stimme im Kopf, die laut schreit "DU BIST NICHT GUT GENUG!", etwas entgegensetzen. Nämlich all die Momente, in denen ich klug und stark und mutig war. Eine gute Freundin. Eine Frau mit Zivilcourage. Eine gewandte Rednerin. Eine, die für sich eingestanden ist, wenn es niemand anderes getan hat. Eine kampferprobte ‘Try me, bitch’, die (zumindest an den guten Tagen) von den Dächern schreit: Fick den Körperkram!
Dieser Text ist Teil des EDITION F Voices Newsletters – meldet euch hier an.