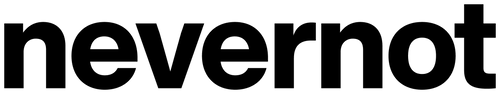Durchgeknallt?
Du bist ja mental! Bist du verrückt? Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank!
Wie oft verwenden wir Begriffe wie diese im Alltag auf witzige, ironische oder manchmal sogar auch leicht boshafte Art und Weise… Letzten Endes ist es gar nicht ausschlaggebend, wie wir sie gebrauchen, denn das Resultat bleibt stets das Gleiche: Irgendetwas stimmt mit dir doch nicht! Bist du krank?
Mental Health, also unsere mentale Gesundheit, fährt seit einigen Jahren mit uns Achterbahn. Der Begriff hat sich langsam, aber doch sehr standhaft in unseren Wortschatz eingebürgert und wird tatsächlich bei den meisten unter uns schon gar nicht mehr hinterfragt. Genau deshalb fragen wir uns: Warum eigentlich nicht?
Sobald es um die Beschaffenheit unserer Gedanken und allem voran unseres Geisteszustandes geht, fragt kaum jemand mehr nach. Es reicht zu wissen, dass etwas mit der Psyche oder auch dem seelischen Wohlbefinden nicht stimmt. Dabei ist dies eines der wenigen Spektren bei dem Benennungen, Kategorisierungen und Schubladendenken hilfreich wären. Wir wollen die eine psychische Krankheit nicht gegen die andere aufwiegen, aber je nach Diagnose, sollte auch unser Umgang mit der Krankheit variieren. Beim Thema Mental Health darf es keine Einheitslösung, keine Einheitsempathie und keine Einheitstoleranz geben.
Körperliche Leiden sind für uns sichtbar und zudem auch greifbar. Sie stoßen auf Verständnis und Lösungsvorschläge. Psychische Belastungen dagegen werden von uns oftmals als abstrakt oder unverständlich empfunden. Dabei geht es ganz besonders dann um uns, unsere Emotionen, unser Wohlbefinden, unsere Lebensqualität und somit auch um unsere Gesundheit. Es ist und bleibt ein Paradox, dass uns Sätze, wie „du schaffst das schon“, „das legt sich wieder“, oder „zieh das durch“ entgegengeschleudert werden, wenn unsere Psyche, das Zentrum unseres Handelns und Denkens, einmal nicht einwandfrei funktioniert, uns aber bei dem kleinsten Schnupfen Bettruhe verordnet und die Möglichkeit auf’s sogenannte „Verschleppen“ in Aussicht gestellt wird. Ist es nicht viel schlimmer, eine psychische Krankheit zu verschleppen?
Umso verwunderlicher ist es, dass wir unser Wohlergehen, wie unsere Augenringe nach einer viel zu kurzen Nacht am nächsten Morgen, einfach verstecken, covern, ja, sogar verschönern möchten. Aus Scham, Angst, Stigma, aber vor allem aus der Erfahrung heraus auf Unverständnis zu stoßen wird zum Oberbegriff, wie zum Concealer gegriffen: „Mir geht es nicht gut. Ich habe mentale Probleme.“ Aber warum nennen wir das Kind nicht beim Namen?* In einer Gesellschaft, die täglich konfrontiert wird mit dem unfreiwilligen Erhalt nächtlicher Dick Pics, öffentlichen Diskussionen von intimsten Bettgeschichten und – weil es gerade so schön passt – dem detaillierten viralen Scheidungskrieg zwischen Johnny und Amber, scheint es noch immer Gefühle wie Scham und Angst in uns hervorzurufen, wenn es darum geht, seine psychische Erkrankung zur Thematik zu machen. Sehen nur wir da die Doppelmoral?
Ein weiterer Faktor ist die inflationäre Nutzung des Wortes: Da bekanntlich zu viele Köche den Brei verderben, ist der Gebrauch der Begriffe „Depression“, „Panikattacke“, „Burnout“, oder auch „Trigger“ mittlerweile so weit verbreitet, schnell gesagt und in den falschen Zusammenhang gesetzt, dass kaum noch dem Wort des tatsächlich Betroffenen Glaube geschenkt wird, solange kein Stempel von anerkannten Ärzt:innen unter der Diagnose prangt.
Trotzdem dürfen wir am Ende nicht vergessen, dass es immense Fortschritte in der Akzeptanz seelischer und geistiger Erkrankungen gibt. Zwar wird auch beim Krankenschein nur der verschönernde Oberbegriff als Symptom genannt, jedoch wird es mittlerweile mit demselben Stellenwert akzeptiert, wie körperliche Beschwerden und Ausfälle – zumindest rein rechtlich.
Wie gehen wir nun aber am besten mit uns und unseren äußeren Einflüssen um? Diesem mulmigen Gefühl in uns einen Namen zu geben, ist tatsächlich der zugleich schwierigste aber auch befreiendste Part. BURN-OUT. ANGSTSTÖRUNG. NARZISSMUS. Bingo, damit können wir arbeiten!
Über eine psychische Erkrankung zu reden, (sei es Burnout, Essstörung, Depression, um nur mal die Top-Drei zu nennen) wird einem immer noch extrem schwer gemacht. Es liegt an uns, dies ein für allemal zu ändern – egal, auf welcher Seite wir stehen. Zuhören, nachfragen, benennen, aussprechen*. Ist dieser Teil einmal gemeistert, sind es stetige, kleine Schritte, die uns näher zum Wohlbefinden führen. Unsere eigene Psyche scheint manchmal zu vergessen, wie wichtig sie eigentlich ist, weswegen es umso essenzieller und wertvoller ist, auszusprechen – ob zu dir selbst oder zu anderen – wie du dich fühlst und was dir hilft. Eine offene Kommunikation über unseren geistigen Zustand erfordert hauptsächlich Mut und umso weicher ist die Wolke, auf der wir landen, wenn diese emotionale Herausforderung auf ein Ohr und eine helfende Hand trifft.
*Jeder Person muss natürlich selbst überlassen sein, wie viel und was sie teilen möchte